Erzähl mir keine Geschichten! Nr. 8 – Leseprobe
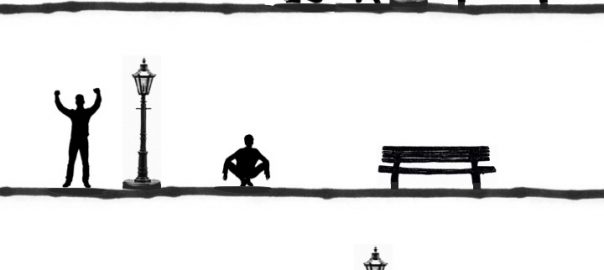
Der Blick aus den Fenstern in den alten Park. Vogeltänzerei.
Diese beflügelte Leichtigkeit befiederter Tänzerinnen und Tänzer ist in ihrer Stille und Akrobatik Natur gewordene Schönheit, von der sie allerdings nichts wissen, genauso wenig wie von den herrlichen Melodien ihrer Lockrufe und Reviergesänge, die sie Tag für Tag der Welt verschwenderisch schenken. Nur wir Menschen umhüllen sie noch zusätzlich mit dem Etikett der Vergänglichkeit. Wie überflüssig, wie pharisäisch! Denn anders als in der lebensfrohen Vogelwelt verstecken wir nur allzu gerne in unseren eigenen schön geredeten Wortgirlanden die düsteren Momente unseres Tuns. Als zäher Nebel kommen sie aber immer wieder zurück in unsere Erinnerungsarbeit, manchmal sehr, sehr viel später. So wie die Geschichte um die polnischen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die auch im Rheinland unter wahrlich unwürdigen Bedingungen arbeiten mussten – die größten Anstrengungen galten dabei aber der Arbeit am Überleben. In Beuel genauso wie in Siegburg, um nur zwei der zahllosen miesen Nester nationalsozialistischer Unterdrückungsorte zu nennen.
Beuel: in der Zeitung dieser Tage ein gestelltes Foto adrett hergerichteter Polinnen, die in ihren Gesichtszügen die Kränkung und die Angst kaum verbergen können, die sie Tag und Nacht in ihrem Würgegriff halten. Jadwiga Pawlowska. Eine von vielen. Sie lebten dicht gedrängt in überfüllten Baracken. Jadwiga Pawlowska starb unter menschenunwürdigen Bedingungen. Tuberkulose, keine ärztliche Hilfe, sie wurde einfach weggesperrt, bis sie starb. Jadwiga Pawlowska. Ein Name unter vielen in Beuel. 1943 – 1945.
Siegburg: Illa (94) erzählt ihrem Sohn beiläufig, dass sie im Betrieb auch polnische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen gehabt hätten. Jeden Tag habe sie eine Suppe für sie gekocht. In welchen Baracken haben sie hausen müssen? Wer waren die Aufseher? Der Sohn versäumt, nachzufragen, die Mutter wechselt das Thema. Was wussten die Seilers von ihren Lebensbedingungen vor Ort, wie wurden sie im Betrieb behandelt? Gab es da auch eine Jadwiga, eine Malgorzata? Tuberkulose? Wo sind sie beerdigt? Was geschah nach den Tagen der Kapitulation am 8. Mai 1945? Wechselte nun die Angst die Seiten? Fürchtete man auf dem Stallberg die Rache der Gedemütigten?
Wie sagt doch Sting in seiner Autobiographie „Broken Music“: „Wir sind alle Trappistenfamilien, jeder gefangen in seinem eigenen Schweigen“. Das haben die Eltern in nachhaltigem Unterricht jeden Tag am Esstisch ihren Kindern beigebracht: zu schweigen. Jadwiga? Wir kennen keine Jadwiga. Was ist das überhaupt für ein komischer Name? Wo hast du das her? Hast du schon die Hände gewaschen? Ab! Aber dalli. So ging das. Und wir Kinder in unserer Angst waren brave Schülerinnen und Schüler im Fach Schweigen.
Später werden wir es unseren eigenen Kinder als Normalfall weiter vorleben. Und unter einem Berg von Werbespots und schriller Musik ist Jad-wiga dann höchstens noch ein hohler Klangkörper fast so wie Rot-China.
Jenseits solchen Schweigens bleibt aber die Stille im Park einfach nur wunderbar, der Lufttanz der Meisen und Amseln kostenlose Schönheit und der vielstimmige Gesang abends und morgens ein reiches Geschenk hochbegabter Sängerinnen und Sänger. Just for free.
Jadwiga – auch ein schöner Klang. Wenn auch mit einem sehr traurigen Unterton.
Małgorzata Chodakowska (* 9. Mai 1965 in Łódź, Polen) ist eine polnische Bildhauerin, die seit 1991 in Dresden lebt und arbeitet. Sie besitzt neben der polnischen seit 2018 auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Neben den sogenannten „Stammfrauen“ – überlebensgroßen Holzskulpturen, die im Stück aus Baumstämmen gehauen werden – gestaltet Chodakowska auch Brunnenfiguren sowie Preisskulpturen für Wettbewerbe. Besondere Aufmerksamkeit erhielt ihre Skulptur Trauerndes Mädchen am Tränenmeer, die seit 2010 in Dresden an die Bombardierung der Stadt 1945 erinnert.
