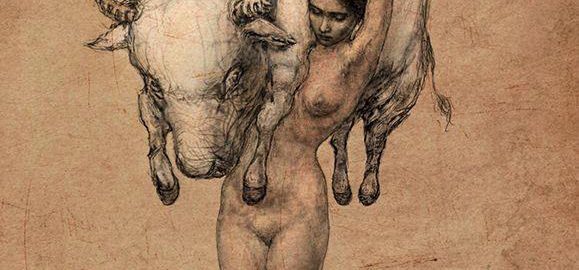Somythall im Gespräch mit den Geistern von Nidda.
Der
Tag, nachdem sie die Furt im großen Strom wohlbehalten, wenn auch
nass und frierend, hinter sich gelassen hatten, beginnt mit Nebel und
Nieselregen. Duc Rochwyn weckt seine Leute früh.
„He,
Wytgos, wach auf, wir müssen los!“
Berolos
neben Wytgos, schnarcht einfach weiter. Wytgos aber ist sofort auf
den Beinen. Ihm ist es eigentlich lieber, wenn er seinen Herrn
aufwecken kann und nicht umgekehrt.
„Wie
weit willst du denn heute kommen, Duc?“ fragt er leise. Die anderen
sollen nicht mitbekommen, was zwischen ihnen besprochen wird.
„Nicht
weit. Nur bis Nidda. Nur ein paar Leugen.“
Wytgos
stutzt. Was hat es denn mit diesem Nidda auf sich, dass er dort
gleich schon wieder Halt machen will?
„Lass
dich überraschen! Und jetzt weck endlich alle auf, los!“
Duc Rochwyn dreht sich um und geht zu der Trauerweide, unter der Somythall mit der kleinen Sumil lagert. Ruth, die neue Amme, ist schon wach und hat am Fluss Windeln gewaschen. Gerade wringt sie sie aus und hängt sie über einen der unteren Äste. Als sie den Duc sieht, hält sie ein und verbeugt sich tief.
„Schön,
dass du dich schon kümmerst. Wir wollen auch bald los. Weck die
beiden, aber sanft, ja!“
Ruth
verbeugt sich noch tiefer. Diese Stimme, diese Stimme, sie geht ihr
durch und durch.
„Ja,
Herr, wir werden uns beeilen.“
Auch
bei den Mönchen kommt Bewegung auf. Bald sind die Pferde wieder
bepackt und gesattelt. Somythall wieder in ihrer Sänfte, Sumil
stillend. Vorneweg Rochwyns Leute, dann die Sänftenträger, dann Abt
Ambrosius und seine Mitbrüder und hinten Rochwyn mit den drei neuen
Männern aus Argentovaria und der restlichen Mannschaft. Viele von
denen, die auch gestern durch die Furt hier angekommen waren, stehen
gaffend da und tuscheln. Was sind das für Leute, wo wollen die hin
und wer ist das in der Sänfte?
Da kämpft sich die Sonne durch den Morgennebel. Somythall schließt die Augen. Schön, dass ihr Töchterlein jetzt von der Sonne gewärmt wird. Auch das Schwanken der Sänfte scheint sie zu mögen. Ruth läuft neben ihr her und lässt ihre Augen nicht von Somythall.
Nicht
viel später hört sie, wie vorne Wytgos sein „Halt!“ ruft, „wir
machen einen Pause!“ Jetzt schon eine Pause? Da schließt Rochwyn
zu ihr auf.
„Somythall,
ich habe eine kleine Überraschung für dich. Nidda.“
Nidda?
Nie gehört, denkt sie. Nidda? Sie schaut Rochwyn mit großen Augen
an. Sumil schläft in Ruths Armen.
„Komm,
steig aus, ich möchte dir etwas zeigen!“
Rochwyn
reicht ihr eine Hand, die sie gerne ergreift und schwingt sich
neugierig
aus der Sänfte. Und als sie sich jetzt umschaut, ist sie völlig
sprachlos: Überall Mauerreste. Säulen, Arkaden, ja, selbst eine
gepflasterte Straße kann sie erkennen.
„Nein!“
ruft sie hoch erfreut.
„Ist
das etwa eine ehemalige römische Stadt, ist das dieses Nidda? Dann
ist dir die Überraschung wirklich gelungen.“
„Noch
vor zwei Generationen gab es hier reges Marktleben. Der Grenzwall der
Römer ist nicht mehr weit, die Germanen bekamen hier all das, was es
bei ihnen nicht gab.“
Dann
wendet er sich an seine Leute, die gelangweilt in der Gegend stehen.
„Wytgos, geht mit den Pferden zum Flüsschen, da können sie
trinken und fressen!“
Und
zum Abt gewandt lässt er wie Brotkrumen, die vom Tisch fallen, die
Wort raus:
„Ambrosius,
betet noch einmal ordentlich, denn hinter diesem verfallenen Flecken
beginnt euer Missionsland. Nichts als Heiden und Krieger!“
Dann
verschwindet er mit Somythall in der stillen Ruinenlandschaft von
Nidda.
Und
mitten drin stoßen sie auf eine große, eine sehr große Säule.
Staunend bleibt Somythall stehen.
„Ist
das nicht eine Jupitersäule?“ fragt sie ganz leise. Eine
eigenartige Wirkung geht von dieser Säule aus. Eigenartige Gefühle
melden sich da in ihr. Eigenartige Bilder erscheinen vor ihrem
inneren Auge.
Rochwyn
nickt. Sie ist eine kluge Frau, denkt er. Am Rande der gepflasterten
Straße liegt ein Leugenstein. Wer den wohl umgestoßen hat?
Somythall setzt sich darauf und schließt die Augen. Sie will mit
ihrer großen Göttin sprechen. Aber da melden sich andere Stimmen.
„Gib
acht, Fremde, gib acht! Der Wald vor dir ist voller böser Geister.
Sie sollten nicht grundlos gestört werden, das weißt du doch –
oder?“
Somythall sieht die Sprecherin ganz deutlich vor sich: Eine Tunika umhüllt ihre stolze Gestalt, das Haar geflochten zu einem langen Zopf, an den nackten Armen glänzen goldene Armreife. Jetzt dreht sie sich um:
„Julianus, geh wieder rein, du sollst die Aeneis auswendig lernen. Dein Großvater erwartet das von dir! Mit wem ich gerade rede? Sei nicht so neugierig, du kennst sie sowieso nicht und jetzt ab ins Haus!“
„Wer
bist du?“ fragt Somythall, „und woher kennst du mich?“
„Beten
wir nicht jeden Tag zur gleichen Göttin, du und ich?“
Somythall
kann es nicht fassen. Ja, es ist ihre Freundin aus so vielen Träumen,
die sie immer wieder auf ihrer langen Reise von Yrrlanth bis hier
nach Nidda nachts getroffen hat. Sie hat es nur immer wieder
vergessen. Aber jetzt, jetzt fällt es ihr wieder alles ein.
„Cornelia
– stimmt‘s?“ fragt sie lächelnd.
„Stimmt,
Somythall. Aber der Glücksmoment ist gleich vorbei, dann muss
ich
wieder zurück!“
Und
gerade, als Somythall sie fragen will, wohin denn zurück,
verschwindet das wunderbare Bild ihrer Freundin in ihrem Tagtraum.
War da nicht sogar noch eine Männerstimme, die sich gerade noch
melden wollte? Zu spät.
„Somythall,
träumst du? Mit wem redest du da?“
Duc
Rochwyn streicht Somythall behutsam über ihr langes rotes Haar. Er
wusste es. Der Geist des Ortes würde sie durchfluten.
„Meine
Freundin hat mich gewarnt. Vor uns liegt unbekanntes, unfreundliches
Land, hat sie gesagt.“
Würde
ja nur zu gern wissen, wie diese Freundin heißt, denkt Rochwyn, aber
sagen tut er es nicht.
„Morgen,
gegen Mittag, werden wir uns von Abt Ambrosius und seinen Mitbrüdern
verabschieden. Damit haben wir unseren Teil des Auftrags erfüllt.
Der seine beginnt dann erst.“
Am
liebsten würde Somythall hier in den Ruinen von Nidda warten, bis
Rochwyn mit seinen Leuten morgen Abend wieder hier sein würde. Aber
sie ist zu stolz, das zu sagen. Die Angst, die Cornelia in ihr
geweckt hat, schickt sie ins Dunkle. Geh, lass mich in Ruh!
Mit
einem Seufzer erhebt sich Somythall von dem Leugenstein, der von der
Morgensonne scheinbar nur für sie vorgewärmt worden war.
„Komm,
Rochwyn, ziehen wir weiter. Abt Ambrosius ist sicher schon ganz
ungeduldig, endlich mit seinem Missionswerk beginnen zu können.“
Zurück
zu den Wartenden gibt Rochwyn sofort den Befehl zum Aufbruch.
Somythall
liegt wieder in der Sänfte, Ruth hat ihr Sumil in den Arm gelegt,
die Männer und die Mönchen kommen an ihr vorbei nicht wissend, was
für einem Unheil sie entgegen reiten.
„Cornelia, Cornelia!“ flüstert Somythall, als sie jetzt durch die ehemalige römische Stadt der civitas Taunensium kommen, „danke für deine Warnung. Ich werde gut auf Sumil und mich aufpassen. Hoffentlich lernt dein Julianus fleißig seine Aeneis!“
Dabei
geht ein feines Lächeln über ihr Gesicht. Ruth sieht es zufällig
und denkt, woran wohl meine Herrin gerade denkt, dass sie so lächelt?
Dann
umgibt sie lichter Buchenwald. Soweit das Auge reicht.