AbB Erneute Annäherungen # 3
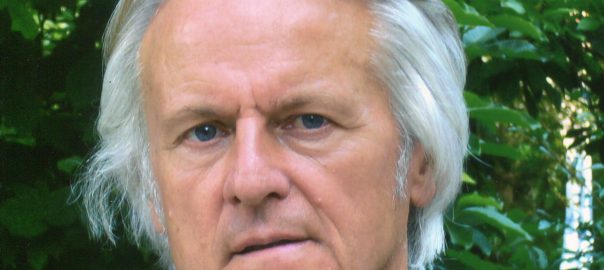
Wider die Natur schon so lange…
Ist es nicht eigenartig, wie hartnäckig wir Europäer an einer Denk- und Glaubensart festhalten, die nicht nur der eigenen ehemaligen religiösen und alltäglichen Welt widersprach, sondern auch dem natürlichen Gang von Werden und Vergehen zuwider läuft?
In der eigenen Biographie wird dem sich Erinnernden deutlich, wie sehr er von Anfang an misstrauisch dem schnellen Zugriff im logischen Denkgebäude für das Richtige und „offensichtlich“ Falsche gegenüber stand. Es blieb ihm lange ein ungeklärtes Geheimnis, wie sicher sich die Erwachsenen um ihn herum in ihrer Begriffswelt und den dazu gehörigen Schlussfolgerungen bewegten – immer mit einem Mienenspiel, das jedem Zweifler unmissverständlich zu verstehen gab: „Stell dich nicht so an, ist doch ganz einfach, sprich es mehrfach nach und schon stellt sich Verstehen ein, wie von selbst, logisch!“
Wie war es möglich, dass man den luftigen Bildern von einem unsichtbaren Jenseits mit einem unsichtbaren Gott (dreifach!) zu folgen bereit war, nachdem das Diesseits als Jammertal, Sündenpfuhl und Irrweg schlecht gemacht worden war?
Gut, schlecht entlohnte Legionäre, enttäuschte Veteranen und die vielen Sklaven und ihre Familien waren vielleicht bereit, an solch eine „späte Rettung und Belohnung im Jenseits“ glauben zu wollen, aber gleichzeitig die Natur als Bedrohung und Fremde zu verhöhnen, widerspricht doch dem Offensichtlichen.
Kleiner historischer Exkurs und Deutungsangebot:
Julian Apostata (360 -363) versuchte in kühnem Zugriff, dieses einseitige und misanthrope Glaubensangebot der jungen Christen und ihrer alten Bischöfe zurückzupfeifen: Es sollten wieder alle allen opfern dürfen, statt nur einem, der keine Götter neben sich duldete! Der Vielfalt in der Natur sollte wieder die Vielfalt der göttlichen Bilder entsprechen, mit der diese natürliche Vielfalt naturnah abgebildet schien. Aber das Glück war nicht auf seiner Seite. Er fiel bei einem Feldzug im Osten des römischen Reiches.
Aber schon zwei Jahre später – 365 – gab die Natur eine starke Antwort: die afrikanische Platte schob sich ruckartig weiter unter die eurasische und ein noch nie da gewesener Tsunami brauste im Mittelmeer von Westen nach Osten und riss tausende von Menschen in den Tod. Als wollte die Natur ein Zeichen geben: Ihr Erdlinge, ihr winzigen, verleugnet nicht eure Natur!
Zeit und Raum sind die Eckdaten von Werden und Vergehen. Darin hängt alles mit allem zusammen und nichts geht verloren, ja, im Gegenteil, es kehrt verwandelt zurück in neuer Form und überraschender Existenz. Das ist auch das Narrativ der östlichen Denker seit Jahrtausenden. Gerade erlebt auch der Osten so etwas wie eine Überfremdung mit einem Bildergebäude, das dem natürlichen und gewordenen Sein so sehr widerspricht. Es ist zwar nicht die Münchhausen-Geschichte vom „ewigen Leben nach dem Tod“ (Bethlehem lässt grüßen!), dafür aber die dialektische Täuschungs-Geschichte vom „materiellen Gewinn für alle beim gerechten Verteilen auf alle (Trier lässt grüßen!)“ – der Katholizismus hat seinen Ursprung im Osten; die Bilder sind fremde Bilder, die als die eigenen gebetsmühlenartig herbei gebetet werden. Der chinesische Sozialismus hat seinen Ursprung im Westen; die Bilder sind fremde Bilder, die als die eigenen gebetsmühlenartig herbei geredet werden. So taumelte man in die fremde Bilderwelt.
In beiden Irrgärten lässt sich gut träumen, andere abzuschlachten und eigene Leute mächtig werden zu lassen. Aber Frieden mit sich und der eigenen Natur lässt sich so nicht finden. Die Todesangst in der Pandemie lässt solche Irrgärten wie Kartenhäuser in sich zusammenfallen. Kopfschüttelnd schaut die Natur diesem üblen Schauspiel zu. Dann zeigt sie den Probanden die gelb-rote Karte.
Und langsam, ganz langsam wagt sich der Erschrockene ans Überdenken altvertrauter Muster. So öffnet sich eine alte Tür nun wie neu. Vielleicht.

